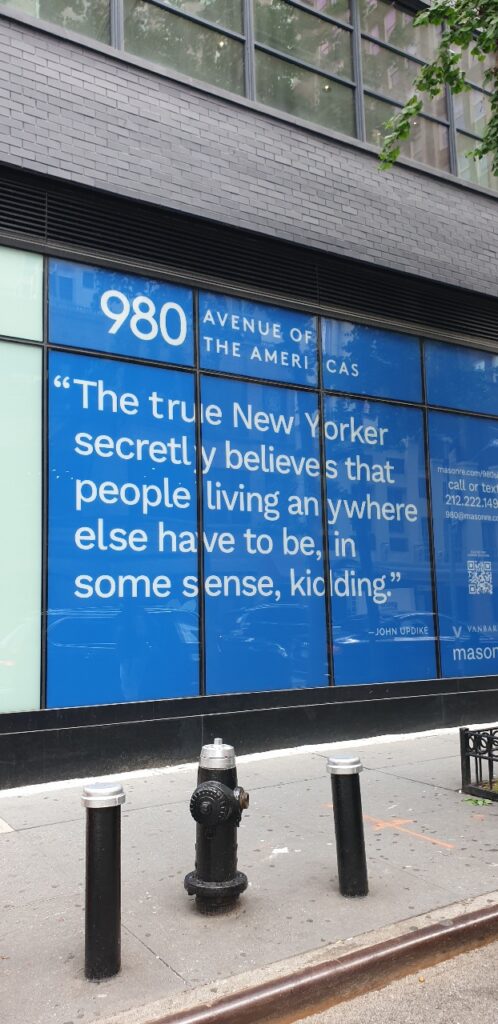Das große Abenteuer in New York beginnt mit Stau. Nicht in den Straßenschluchten Manhattans, sondern an der Immigration am Flughafen. Hunderte von Menschen stehen vor uns in den Schlangen, die sich in entmutigend vielen Windungen den Schaltern der Einreise-Beamten entgegenquält. Der Ton des Einweisers ist militärisch laut und knapp, als er die Reisenden in Schlangen für US-Bürger und Schlangen für Nicht-US-Bürger einteilt. Die Sonne brennt auf das Glasdach der Halle, Zentimeter für Zentimeter schieben sich die still schwitzenden Wartenden voran. Ein kleiner Junge bekommt einen kapitalen Wutanfall und lässt die ganze Wartehalle wissen, dass seine Schwester ihn zuerst geschubst hat. Die Frau vor mir starrt minutenlang einen Fleck in der Luft an, ich denke, „jetzt bloß nicht aufs Klo müssen, das kann dauern hier.“ Es dauert. Zwei Stunden, in denen wir genug Zeit haben, unsere Paranoia zu füttern und uns auszumalen, mit welchen perfiden Fragen uns die Einreisebeamten löchern werden, um herauszufinden, ob wir die Absicht haben, uns in den USA häuslich niederzulassen anstatt das Land brav nach 90 Tagen wieder zu verlassen. Die US-Grenzbehörden sind berüchtigt für ihre humorlose Strenge, ihre Macht, jedem die Einreise zu verwehren, dessen Nase ihnen nicht passt, macht sie zu gefürchteten Türstehern ins Land der Freien. Ich male mir aus, wie die Laune der Officers mit steigender Temperatur und Menschenmenge sinkt und wie sie das von Minute zu Minute gereizter macht. Als wir endlich mit flatterdem Magen und schwitzigen Handflächen an einem der Glashäuschen stehen, werden wir mit einem freundlichen „Hallo, willkommen in New York, bitte zeigen Sie mir Ihre Dokumente“ begrüßt. Ein lächelnde Beamter, der keine einzige Frage stellt, höflich „bitte“ und „danke“ sagt, unsere Fingerabdrücke nimmt und uns ohne Umschweife ein 90 Tage-Visum in den Pass stempelt. Wieder mal zu viele Gedanken gemacht. Auch unsere riesigen Rucksäcke liegen unberührt neben dem Gepäckband – Nicos Schreckensvisionen von schnüffelnden Hunden, die unsere Flasche Wein entdecken oder misstrauischen Zöllnern, die uns fragen, warum wir einen Komplettsatz Dichtungen für einen Mercedes Sprinter sowie zwölf Filterkartuschen für ein Frischwassersystem im Gepäck haben, waren unnötig.

Nachdem es uns geglückt ist, das richtige Ticket für die Fahrt vom Flughafen nach Manhattan aus der Maschine zu ziehen, warten wir. Der Bahnsteig ist verlassen, der Flughafen JFK liegt so weit draußen, dass die nachmittägliche Stille nur vom Brummen der Rolltreppe durchbrochen wird, die ab und zu weitere Reisende und ihre Koffer auf den Bahnsteig befördert. Ein Wohltat nach dem Lärm und Gedränge der Ankunftshalle. Nach 15 Minuten ist immer noch kein A-Train Richtung Manhattan erschienen – die einzige Linie, die hier hält. Ich denke: „Die fährt wahrscheinlich nur zwei Mal die Stunde, um diese verlassene Gegend an die City anzubinden.“ Weitere zehn Minuten, dann fährt der Zug endlich ein – und ist so vollgestopft mit Leuten, wie man das sonst nur von Bildern aus Tokio kennt. Wir rennen mit unseren schweren Rucksäcken an den silberfarbenen Wagons entlang und suchen verzweifelt nach einem Eingang, an dem sich eine Lücke auftut, in die wir passen. Irgendwann sind wir drin, stehen wie die Sardinen zwischen hunderten Menschen und rätseln, wo die alle herkommen. Von Coney Island, dem beliebten New Yorker Stadtstrand, wie sich später herausstellt. Von wegen „verlassene Gegend“. Mehr als eine Stunde lang stehen wir, mit vom Gewicht unserer Rucksäcke schmerzenden Schultern und Füßen, in der rumpelnden Bahn, dann sind wir endlich auf der 8th Avenue und schleppen uns die letzten neun Blocks zu Fuß ins Leo House, unsere Unterkunft für die nächsten zwölf Nächte. Es ist 18 Uhr New Yorker Zeit – Mitternacht auf unserer inneren Uhr, und wir sind müde wie tausend Mann. Seit 18 Stunden auf den Beinen, 17 davon mit FFP2-Maske. Wir wollen nur noch ein Bier, was Schnelles zu essen und ins Bett. Sind zu k.o., um ernsthaft darüber schockiert zu sein, dass das Bier acht Dollar kostet (plus Steuern, plus Trinkgeld, das in den USA etwa mit 20% angesetzt wird – zahlt man es nicht, kann die Kellnerin gegebenenfalls ihre Miete nicht bezahlen) und ein Salat ohne Dressing 18 Dollar – New York, here we are!

Wie zu erwarten, sind wir am nächsten Morgen früh munter. Beschließen, nach der gesalzenen Rechnung gestern unser Frühstück lieber im Supermarkt zu besorgen – und stellen fest, dass es nicht an dem Diner lag: Auch im Supermarkt herrscht ein Preisgefüge, bei dem wir uns fragen, wie die New Yorker das machen. Verdienen die hier alle Manager-Gehälter? Wir schnappen uns zwei Sandwiches, eine Banane, ein kleines Schälchen Obstsalat und einen Cookie, zahlen dafür 24 Dollar und ziehen los in den strahlenden Morgen auf der Suche nach einer Parkbank oder einem anderen Ort, an dem wir in Ruhe unser Luxus-Frühstück verspeisen können. Landen nach ein paar Blocks im Madison Square Park, der uns sofort in Entzücken versetzt. Das kleine Stück Grün direkt am Flatiron Building, eingeklemmt zwischen Broadway, 6th Avenue und die 23. Straße, liegt unter schattigen Baumkronen, hinter denen die ikonische Spitze des Empire State Buildings hervorlugt. Im Zentrum des eher an einen großen Garten erinnernden Parks sprudelt ein munterer Brunnen – und überall stehen Tische und Stühle, die die New Yorker und ihre Gäste dazu einladen, sich zu setzen, zu picknicken, zu plaudern oder sich einfach nur die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Es gibt sogar WLAN – wir sind begeistert! Eineinhalb Stunden sitzen wir hier, genießen den stillen Sonntagmorgen (in den folgenden Tagen werden wir feststellen, dass die Stadt an Wochentage deutlich lauter brummt!), beobachten Mütter mit Kinderwagen, Jogger, Spaziergänger und Leute mit Hunden bei ihrem morgendlichen Treiben.
Irgendwann reißen wir uns los und tun das, was alle Touristen tun: Machen uns zu Fuß auf in Richtung Midtown, um all die Wahrzeichen der Stadt zu begrüßen, die wir von früheren Besuchen aber auch und vor allem aus zahllosen Kinofilmen kennen. Und die mir immer ein Gefühl der Vertrautheit mit dieser Stadt vermitteln, die ich in Wirklichkeit gar nicht haben kann nach nur einem längeren und einem eher kurzen Aufenthalt hier 1996 und 2008. Ein Gefühl, das mich in den nächsten Tagen immer wieder zum Nachdenken darüber bringen wird, was ich hier eigentlich sehe. New York? Meine Erinnerung an New York? Meinen Wunsch danach, wie diese Sehnsuchtsstadt für mich sein soll?